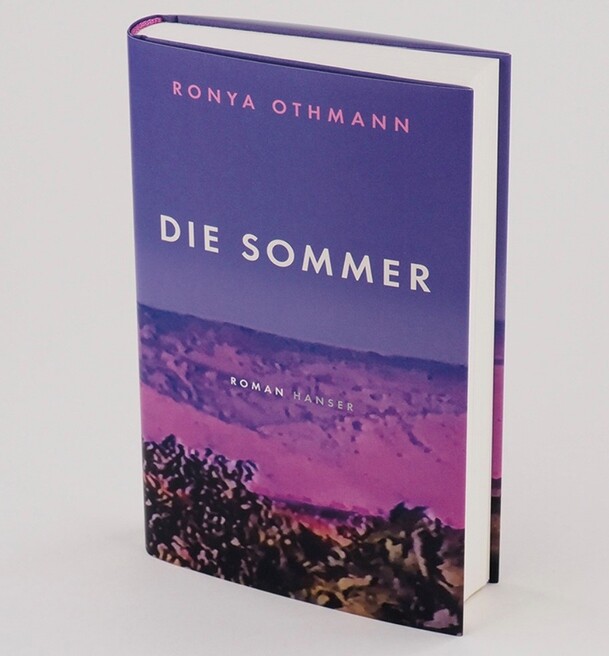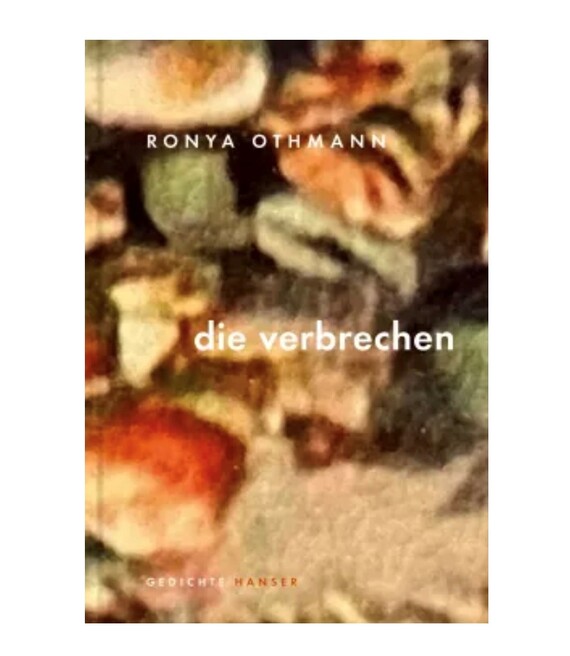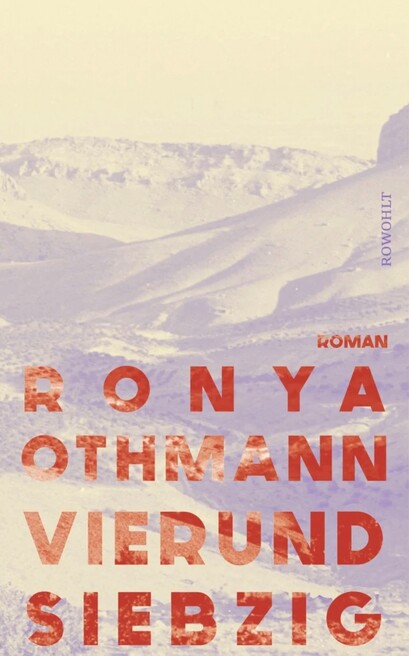Ronya Othmann
Bereich: Literatur
Key Facts
Nationalität
DeutschlandBereich
LiteraturWohnort
MünchenEmpfehlende Institution
BMEIAZeitraum
Juli 2025 - August 2025Ronya Othmann wurde 1993 in München geboren, studierte am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig und lebt heute in Berlin. Sie schreibt Lyrik, Prosa und Essays und arbeitet als Journalistin. Seit 2021 schreibt sie für die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung alle zwei Wochen die Kolumne „Import Export“. Im Sommersemester 2023 unterrichtete sie an der Sprachkunst in Wien. Im Juni 2024 kuratiert sie im Deutschen Filmmuseum Frankfurt eine Veranstaltungsreihe zu „Kino und Lyrik“. Für ihr Schreiben wurde sie viele Male ausgezeichnet, unter anderem mit dem Lyrik-Preis des Open Mike, dem MDR-Literaturpreis, dem Publikumspreis des Ingeborg-Bachmann Wettbewerb und dem Caroline-Schlegel-Förderpreis für Essayistik. Für „Die Sommer“, ihren ersten Roman, bekam sie 2020 den Mara-Cassens-Preis zugesprochen, für den Lyrikband „die verbrechen“ (2021) den Orphil-Debütpreis, den Förderpreis des Horst-Bienek-Preises sowie den Horst Bingel-Preis 2022. Ihr zweiter Roman „Vierundsiebzig“ wurde mit dem Düsseldorfer Literaturpreis und dem Erich-Loest-Preis ausgezeichnet und stand auf der Shortlist des Deutschen Buchpreis.
Instagram: @RonyaOthmann
Während ihrer Residency im MQ arbeitet Ronya Othmann weiter an einem Langgedicht, das sich mit dem Thema Exil und Verbannung auseinandersetzt. Zentrale Figuren sind der antike Dichter Ovid und die kurdische Sängerin Ayşe Şan, in deren Leben und Werk das Exil eine prägende Rolle spielte. Ayşe Şan stand in der Tradition der Dengbêj, der kurdischen Barden, und gilt als eine der bekanntesten Vertreterinnen dieser Kunstform.
Geboren 1938 in Diyarbakır (Amed), wuchs sie in einer Dengbêj-Familie auf, begann früh zu singen und trat – gegen den Willen ihrer Familie und trotz der gesellschaftlichen Einschränkungen als Frau – öffentlich auf. Sie sang auf Kurdisch, in einer Zeit, in der die kurdische Sprache in der Türkei verboten war. Um sich ganz der Musik widmen zu können, verließ sie Mann und Kind, arbeitete zunächst als Näherin und später als Postbeamtin in Izmir. Nach dem Militärputsch 1971 ging sie ins Exil nach München.
Das Langgedicht greift auch Ovids Briefe aus der Verbannung auf. Es verbindet Echos aus zwei Jahrtausenden, durchquert den Mittelmeerraum, Europa und dessen Ränder – nicht nur als geographischen und politischen Raum, sondern auch als geteilten Kulturraum.